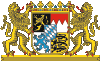Erste Ernte von Seggensamen in Karolinenfeld – ein wichtiger Schritt vorwärts für die Paludikultur
Besonders geeignet sind Arten wie Rohrkolben, Schilf, Rohrglanzgras oder Seggen. Für Südbayern erweist sich insbesondere die Sumpf-Segge (Carex acutiformis) als aussichtsreich: Sie ist nicht nur robust gegenüber schwankenden Wasserständen, sondern bildet innerhalb eines Jahres dichte, nahezu erntereife Bestände – deutlich schneller als etwa Schilf oder Rohrkolben. Ganz wichtig ist die Fähigkeit, geschlossene und einheitliche Bestände zu bilden. Der Fachmann spricht von Monodominanz: nur eine Pflanze, die Segge, dominiert den Bestand. Dieser reine Bestand bietet auf der Seite der Verarbeitung große Vorteile insbesondere bei automatisierten Verfahren
Die größte Herausforderung ist derzeit die Verfügbarkeit von Saatgut. Carex acutiformis wurde bislang kaum in Kultur genommen, und Saatgut ist lediglich in kleinen Mengen aus Wildsammlungen – meist aus Südosteuropa – erhältlich. „Als das Projekt Moorbewi 2020 startete, befanden sich etwa 90 % des in Deutschland verfügbaren Saatguts im Besitz der Wissenschaftler am PSC der HSWT – und das waren insgesamt weniger als zwei Kilogramm“, erinnert sich Dr. Sticksel, Leiter des Staatsgutes Freising.
Diese Ausgangssituation macht deutlich, wie wichtig die eigene Saatgutproduktion ist, um die Ausweitung des Seggenanbaus voranzutreiben.
Seit Anfang 2025 arbeiten die BaySG im Rahmen eines neuen Projekts gezielt daran, diese Versorgungslücke zu schließen. Ein erster Ernteversuch mit einem Parzellmähdrescher aus dem Stand fand im Jahr 2024 statt. „Die Tragfähigkeit des wiedernässten Moores ist für den Parzellenmähdrescher, der mit schmalen Reifen ausgestattet ist, nicht ausreichend“, so die Beobachtung von Betriebsleiter Andreas Walz, der die Versuche vor Ort betreut.
Ansätze, den gesamten Aufwuchs zu beernten und schonend zu trocknen, mussten verworfen werden, weil keine auseichend groß dimensionierte Trocknung zur Verfügung steht. Deshalb entschied sich das Team 2025 für eine Ernte von Hand. Gemeinsam mit den Projektkräften des PSC und den Mitarbeitern der Versuchstation wurden die Samenstände mit einer Schere abgeschnitten, eingesammelt und luftgetrocknet. Die bei der Trocknung ausgefallenen Körner bilden den ersten Teil der Ernte. Anschließend werden die Samenstände in einem speziellen Drescher ausgedroschen.
„In Karolinenfeld erweitern wir unsere Anbaufläche für Seggen kontinuierlich“, so Betriebsleiter Walz, „deshalb machen wir uns verstärkt Gedanken, mit welcher Technik wir zukünftig auch auf großen Flächen Saatgut effizient gewinnen können“.
Aktuell überwiegt derzeit aber die Freude darüber, dass in 2025 eine nennenswerte Menge an Seggensaatgut gewonnen werden konnte – ein wichtiger Schritt für die Ausdehnung des Anbaus in Karolinenfeld und darüber hinaus.

einheitlicherb Bestand: Seggenreinbestand