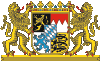Proteinversorgung von Legehennen
Bereits heute werden Extraktionsschrote aus Raps und Sonnenblumen sowie – sofern verfügbar – auch Sämereien heimischer Eiweißpflanzen in bedeutenden Anteilen in der Legehennenfütterung eingesetzt. Allerdings reichen die Alternativen zum Überseesoja bei Weitem nicht aus, um es in der Fütterung von Geflügel, Schweinen und Rindern vollständig zu ersetzen.
Neben dem begrenzten Anbauniveau wird der Einsatz heimischer Eiweißfuttermittel auch durch deren suboptimale Eigenschaften aus Sicht der Tierernährung limitiert. Aufgrund der enthaltenen Antinutritiva und der gegenüber Sojaschrot geringen Gehalte an schwefelhaltigen Aminosäuren gibt es Einsatzrestriktionen, die als Richtwerte für den maximalen Anteil des einzelnen Futtermittels in der Rezeptur gelten.
Neben dem begrenzten Anbauniveau wird der Einsatz heimischer Eiweißfuttermittel auch durch deren suboptimale Eigenschaften aus Sicht der Tierernährung limitiert. Aufgrund der enthaltenen Antinutritiva und der gegenüber Sojaschrot geringen Gehalte an schwefelhaltigen Aminosäuren gibt es Einsatzrestriktionen, die als Richtwerte für den maximalen Anteil des einzelnen Futtermittels in der Rezeptur gelten.
Will man Soja komplett aus den Rationen nehmen, müssen drei bis fünf verschiedene heimische Proteinalternativen in einer Ration kombiniert werden, um die Einsatzrestriktionen zu befolgen und um die erforderlichen Inhaltsstoffe – z. B. 11,4 MJ ME, 17 % bis 18 % Rohprotein, 3 bis 5 % Rohfaser, 0,40 % Methionin – zu erreichen.
Die Auswirkungen einer solchen Ration auf Futteraufnahme, Leistung und Eiqualität oder auf die ileale Verdaulichkeit und den intermediären Stoffwechsel von Legehennen bei vollständigem Verzicht auf Sojabohnen und/oder Sojaschrote sind nicht bekannt. Deshalb sollten Möglichkeiten und Grenzen der Substitution von Sojaprotein durch europäische Eiweißfuttermittel von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und dem Projektpartner Mega Tierernährung in einem Praxisversuch ausgelotet werden.
Die Auswirkungen einer solchen Ration auf Futteraufnahme, Leistung und Eiqualität oder auf die ileale Verdaulichkeit und den intermediären Stoffwechsel von Legehennen bei vollständigem Verzicht auf Sojabohnen und/oder Sojaschrote sind nicht bekannt. Deshalb sollten Möglichkeiten und Grenzen der Substitution von Sojaprotein durch europäische Eiweißfuttermittel von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und dem Projektpartner Mega Tierernährung in einem Praxisversuch ausgelotet werden.
Versuchsaufbau
Der Versuch wurde mit 660 LSL-Classic- und 660 LB-Classic-Hennen durchgeführt. Die Tiere sind am Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum (LVFZ) für Geflügel in Kitzingen geschlüpft, wurden nicht schnabelgekürzt und in Bodenhaltung 18 Wochen aufgezogen. Der Versuch startete am 18. Februar 2015 in der 19. Lebenswoche (LW) nach der Umstallung in einen Fensterstall mit geregelter Unterdrucklüftung und Sprühkühlung. Die Vorlegephase umfasste die 19. und 20. LW, die Legeperiode dauerte vom 05. März 2015 bis 02. März 2016 (21. bis 72. LW).
Versuchsgruppen
Es standen 44 Stallabteile einer einetagigen Bodenhaltung mit jeweils 4,07 m2 zur Verfügung. Die Besatzdichte (30 Tiere/Abteil) betrug 7,4 Tiere/m2.
Es wurden vier Futtervarianten (Kontrolle und drei Versuchsvarianten) mit jeweils elf Wiederholungen à 30 Legehennen über ein Legejahr geprüft. Die jeweiligen Phasenmischungen der vier Futtervarianten waren isoenergetisch und isonitrogen (= gleicher Energie- und Stickstoffgehalt) und wiesen die gleichen Konzentrationen an Mineral- und Zusatzstoffen auf (Tabelle 1). Die Futter der einzelnen Fütterungsphasen entsprechen den marktüblichen Gegebenheiten für ein modifiziertes, praxisübliches, dreiphasiges Fütterungssystem für Legehennen und wurden in Abstimmung mit dem Projektpartner Mega Tierernährung im Futterwerk Straubing hergestellt.
Es wurden vier Futtervarianten (Kontrolle und drei Versuchsvarianten) mit jeweils elf Wiederholungen à 30 Legehennen über ein Legejahr geprüft. Die jeweiligen Phasenmischungen der vier Futtervarianten waren isoenergetisch und isonitrogen (= gleicher Energie- und Stickstoffgehalt) und wiesen die gleichen Konzentrationen an Mineral- und Zusatzstoffen auf (Tabelle 1). Die Futter der einzelnen Fütterungsphasen entsprechen den marktüblichen Gegebenheiten für ein modifiziertes, praxisübliches, dreiphasiges Fütterungssystem für Legehennen und wurden in Abstimmung mit dem Projektpartner Mega Tierernährung im Futterwerk Straubing hergestellt.
Verwendete Eiweißkomponenten
In Tabelle 2 sind die in Phase I verwendeten Eiweißkomponenten dargestellt. Wie heute üblich, war bereits im Kontrollfutter ein Teil des Sojaextraktionsschrotes (15,7 %) durch heimische Proteinfutter (hier getrocknete Weizenschlempe = DDGS) ersetzt. Im Versuchsfutter 1 wurden ca. 53 % des Überseesojas durch0,16Raps- und Sonnenblumenprodukte substituiert. In den Versuchsgruppen (V) 2 und 3 wurde komplett auf Sojaextraktionsschrot (SES) verzichtet, wobei in der V2 hauptsächlich Sonnenblumenschrot (16 %) verwendet wurde, während in V3 vornehmlich Rapsprodukte (insgesamt 16 %) zum Einsatz kamen. Der restliche Proteinbedarf wurde in V2 und V3 durch DDGS und Maiskleber abgedeckt (Tabelle 2). In Phase III wurde DDGS aufgrund der Verfügbarkeit durch ernährungsphysiologisch günstiger zu bewertende Erbsen ersetzt.
Alleinfuttermischungen
Die eingesetzten Alleinfuttermischungen unterscheiden sich nicht nur in den Proteinkomponenten sondern auch in der Farbe, Struktur und möglicherweise auch im Geschmack. Letzterer spielt beim Geflügel zwar eine eher untergeordnete Rolle, sollte aber bei der Verwendung alternativer Eiweißfuttermittel, insbesondere bei hohen Einsatzraten (ca. > 20 %), nicht ganz außer Acht gelassen werden. Die Farbe der Mischungen ohne Soja ist durch die schwarzen Schalenanteile der Sonnenblumen und des Raps deutlich dunkler. Es ist bekannt, dass Legehennen gelbe und rötliche Partikel (Mais, Weizen Soja) den grünen (Erbsen), bläulichen (Roggen/Triticale) oder schwarzen Futterbestandteilen (Raps, Sonnenblumenschrot) vorziehen.
Empfohlen wird, dass der Hauptanteil des Futters eine mittlere Partikelgröße (70 bis 80 % zwischen > 0,5 bis 3,2 mm) und somit eine hohe Homogenität aufweist. Entscheidend ist eine hohe Homogenität bei griffiger Struktur und nur mäßigen Fein- und geringen Grobanteilen. Ein hoher Anteil grober Partikel kann vor allem bei nicht schnabelkupierten Hennen selektives Fressen fördern. Ein hoher Feinmehlanteil kann die Futteraufnahme reduzieren.
Mit der Substitution des Sojas durch heimische Eiweißkomponenten wurden bei gleicher Mahl- und Siebtechnik je nach Einzelkomponenten sehr unterschiedliche Strukturbänder im Alleinfutter gefunden, wobei die untersuchten Futter im mittleren Strukturbereich zwischen > 0,5 mm und < 2,0 mm ein vergleichsweise gutes, homogenes Strukturband aufwiesen.
Empfohlen wird, dass der Hauptanteil des Futters eine mittlere Partikelgröße (70 bis 80 % zwischen > 0,5 bis 3,2 mm) und somit eine hohe Homogenität aufweist. Entscheidend ist eine hohe Homogenität bei griffiger Struktur und nur mäßigen Fein- und geringen Grobanteilen. Ein hoher Anteil grober Partikel kann vor allem bei nicht schnabelkupierten Hennen selektives Fressen fördern. Ein hoher Feinmehlanteil kann die Futteraufnahme reduzieren.
Mit der Substitution des Sojas durch heimische Eiweißkomponenten wurden bei gleicher Mahl- und Siebtechnik je nach Einzelkomponenten sehr unterschiedliche Strukturbänder im Alleinfutter gefunden, wobei die untersuchten Futter im mittleren Strukturbereich zwischen > 0,5 mm und < 2,0 mm ein vergleichsweise gutes, homogenes Strukturband aufwiesen.

Datenerfassung
Es wurden über ein Legejahr die Legeleistung, der Futterverzehr, die Verluste, das Eigewicht und die Gewichtsklassen einschließlich Schmutz- und Knickeier für jedes Abteil erfasst. Darüber hinaus wurden die Struktur von Phasenfutter 2 mittels Siebanalyse und die Schalenstabilität am Ende der Legeperiode (70. LW) ermittelt. In der 30. Legewoche fand ein sensorischer Test der Braunleger-Eier statt.
Die Ergebnisse im Überblick
Die Substitution von SES durch heimische Eiweißfuttermittel hatte in dem hier vorgestellten Versuch folgende Auswirkungen:
- Signifikant geringerer Futterverzehr bei den Braunlegern in den Versuchsgruppen 1 und 3 gegenüber den anderen Varianten. Kein statistisch gesicherter Einfluss der Futterzusammensetzung auf den Futterverzehr bei den LSL-Hennen. Trotz des in aller Regel hohen Einsatzes von alternativen Proteinträgern kam es in keiner der Versuchsgruppen zu versorgungsrelevanten Futteraufnahmerückgängen.
- Veränderung der Farbe und Struktur des Futters:
Die Varianten mit hohem Raps- (16 %) oder SB-Anteil (16 %) waren dunkler und zeigten mehr Feinanteile (< 0,5 mm Partikelgröße) und weniger grobe Partikel (2,01 bis 2,50 mm). - Kein signifikanter Effekt der Futtervariante auf die Legeleistung, die Futterverwertung und die Mortalität bei den LSL-Legehennen. Tendenziell sogar bessere Performance bei den LB-Hennen in den Versuchsgruppen im Vergleich zur Kontrolle.
- Die Eimasseproduktion lag bei beiden Genetiken in der V1-Variante am höchsten. Bei den LB-Hennen befinden sich alle Versuchsgruppen gegenüber der Kontrolle tendenziell im Vorteil. Die V2- und V3-Varianten zeigten bei den LSL-Hennen tendenziell eine niedrigere Eimasseproduktion als die Kontrolle.
- Signifikante Reduktion der Einzeleigewichte und Gewichtsklassensortierung bei LSL und LB bei 100 % Substitution von SES durch Rapsprodukte oder SBS.
- 28,4 % der beprobten braunschaligen rohen Eier zeigten bei sehr hohen Anteilen von Rapsprodukten im Futter (V3) leichte Geruchsabweichungen.
- Erhöhte Schmutzeieranteile in der Variante V2 (SB) sowohl bei LB als auch bei LSL.
Ergebnisse im Detail
Futteraufnahme
Die beschriebenen Unterschiede in Farbe und Struktur der getesteten Futtermischungen könnten eine der Ursachen für die festgestellten Differenzen im Futterverzehr sein. Braunleger, die mit der rapsbetonten Mischung (V3) versorgt wurden, zeigten einen täglichen Futterverbrauch von 120 g je Tier und damit 5,4 g weniger als die Tiere der Kontrollvariante. Diese Differenz, die sich im Jahr auf 1,971 kg Futter kumuliert, war signifikant. Auch die Versuchsgruppe V2 verzehrte signifikant (3,9 g je Tier und Tag) weniger Futter als die Kontrolle, während V2 eine Mittelstellung einnahm und sich lediglich von V3 abhob.
Unabhängig von den Differenzen zwischen den Futtervarianten haben die Hennen aller Gruppen täglich 120 g Futter und mehr verzehrt. Somit dürfte es kaum zu bedeutenden Nährstoffdefiziten aufgrund einer zu geringen Futteraufnahme gekommen sein.
Bei den Weißlegern verzehrten die Tiere der Kontrollgruppe zwar auch am meisten Futter, jedoch war die Differenz zu den Versuchsvarianten geringer (1,0 bis 1,4 g/Tier und Tag, Tabelle 3 auf Seite 19) und nicht signifikant. Möglicherweise reagieren LSL-Hennen nicht so sensibel auf die Versorgung mit unterschiedlichen Proteinkomponenten oder auf Abweichungen in der Futterstruktur und -farbe.
Unabhängig von den Differenzen zwischen den Futtervarianten haben die Hennen aller Gruppen täglich 120 g Futter und mehr verzehrt. Somit dürfte es kaum zu bedeutenden Nährstoffdefiziten aufgrund einer zu geringen Futteraufnahme gekommen sein.
Bei den Weißlegern verzehrten die Tiere der Kontrollgruppe zwar auch am meisten Futter, jedoch war die Differenz zu den Versuchsvarianten geringer (1,0 bis 1,4 g/Tier und Tag, Tabelle 3 auf Seite 19) und nicht signifikant. Möglicherweise reagieren LSL-Hennen nicht so sensibel auf die Versorgung mit unterschiedlichen Proteinkomponenten oder auf Abweichungen in der Futterstruktur und -farbe.
Legeleistung
Die zum Teil sehr deutlich ausgeprägten Unterschiede in der Legeleistung je Anfangshenne (AH) konnten statistisch nicht abgesichert werden. Die produzierte Eizahl lag bei den LB-Hennen in der Kontrollgruppe mit 286 Eiern/AH am niedrigsten. Die tendenziell höchste Legeleistung besaßen die LB-Hennen mit rapsbetonter Fütterung (300 Eier/AH). Tendenziell zeigten alle Braunleger-Versuchsgruppen eine bessere Performance als die Kontrollgruppe.
Die LSL-Hennen hatten eine deutlich bessere Persistenz und legten mit 87,7 % (V2) bis 89,9 % (V1) ca. 5,2 bis 10,3 % mehr Eier/AH als die LB-Hennen (Tabelle 3). Beim Vergleich der beiden Genetiken waren bei gleicher Futtervariante Unterschiede von 22 bis 35 Eiern je AH und Jahr zugunsten der Weißleger auszumachen. Der kombinierte Einsatz verschiedener Proteinträger (V1) generierte bei den Weißlegern die höchste Legeleistung, jedoch ohne signifikanten Unterschied zu den weiteren Gruppen. Der Einfluss der getesteten Futtermischungen war bei den LSL-Hennen in der Legeleistung/AH mit einer Differenz von 2,2 % zwischen den Extremen (V2: 87,7 % zu V1: 89,9 %) geringer ausgeprägt als bei den LB-Tieren mit 3,9 % (Kontrollgruppe: 78,6 % zu V3: 82,5 %).
Die LSL-Hennen hatten eine deutlich bessere Persistenz und legten mit 87,7 % (V2) bis 89,9 % (V1) ca. 5,2 bis 10,3 % mehr Eier/AH als die LB-Hennen (Tabelle 3). Beim Vergleich der beiden Genetiken waren bei gleicher Futtervariante Unterschiede von 22 bis 35 Eiern je AH und Jahr zugunsten der Weißleger auszumachen. Der kombinierte Einsatz verschiedener Proteinträger (V1) generierte bei den Weißlegern die höchste Legeleistung, jedoch ohne signifikanten Unterschied zu den weiteren Gruppen. Der Einfluss der getesteten Futtermischungen war bei den LSL-Hennen in der Legeleistung/AH mit einer Differenz von 2,2 % zwischen den Extremen (V2: 87,7 % zu V1: 89,9 %) geringer ausgeprägt als bei den LB-Tieren mit 3,9 % (Kontrollgruppe: 78,6 % zu V3: 82,5 %).
Futterverwertung
In der Futterverwertung wurde ebenfalls nur ein Effekt der Genetik zugunsten der LSL (2,148 bis 2,202 kg Futter/kg Eimasse) im Vergleich zu LB festgestellt (2,311 bis 2,378 kg Futter/kg Eimasse). Die Differenzen zwischen den Futtergruppen in der Futterverwertung waren über die gesamte Legeperiode marginal. Lediglich im ersten Legemonat wurde eine signifikant unterschiedliche Effizienz der Futterumwandlung in Eimasse bei den Braunlegern festgestellt. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Varianten V1 und V3 die Legereife etwas eher erreichten als die Kontrolle und V2.
Die zum Teil stark ausgeprägten Unterschiede in der Mortalität zwischen den Futtergruppen (LB von 2,8 % bis 9,3 %, LSL von 5,3 % bis 9,3 %) waren wegen der begrenzten Anzahl von Tieren (ein verendetes Tier verändert die Verlustrate um 0,6 bis 0,7 %) und Wiederholungen (fünf bis sechs je Genetik und Futtergruppe) statistisch nicht gesichert. Bei den LSL-Hennen war eine Abgangsursache dominant: Zehenkannibalismus (31 von 48 verendeten in dessen Folge). Diese Verhaltensstörung trat aber in allen Futtervarianten auf. Inwieweit es sich hierbei um eine Problematik handelt, die mit intakten Schnäbeln in Verbindung steht, lässt sich aus den vorliegenden Beobachtungen nicht ableiten.
Die zum Teil stark ausgeprägten Unterschiede in der Mortalität zwischen den Futtergruppen (LB von 2,8 % bis 9,3 %, LSL von 5,3 % bis 9,3 %) waren wegen der begrenzten Anzahl von Tieren (ein verendetes Tier verändert die Verlustrate um 0,6 bis 0,7 %) und Wiederholungen (fünf bis sechs je Genetik und Futtergruppe) statistisch nicht gesichert. Bei den LSL-Hennen war eine Abgangsursache dominant: Zehenkannibalismus (31 von 48 verendeten in dessen Folge). Diese Verhaltensstörung trat aber in allen Futtervarianten auf. Inwieweit es sich hierbei um eine Problematik handelt, die mit intakten Schnäbeln in Verbindung steht, lässt sich aus den vorliegenden Beobachtungen nicht ableiten.
Eigewichte

Der eindeutigste Effekt der getesteten Futtervarianten ergab sich beim Eigewicht und der Gewichtsklassenverteilung. Sowohl zu Legebeginn als auch über den gesamten Versuchszeitraum zeigte sich ein Dosis-Wirkungs-Effekt. Mit der Reduktion des Sojaanteils von der Kontrolle über die Variante V1 (53 % des Sojas ersetzt) bis zu den Versuchsgruppen ohne Sojaextraktionsschrot (V2 und V3) sank das Eigewicht sowohl bei den LSL- als auch bei den LB-Hennen. Bei den raps- und sonnenblumenbetonten Varianten (V2 und V3) wurden bei den Braunlegern mit Eigewichten von 63,3 g (V2) bzw. 62,1 g (V3), bei den LSL von 62,3 g (V2) und 62,0 g (V3) ca. 2 g niedrigere Eigewichte festgestellt als in der Kontrolle. V1 nahm mit 63,6 g (LB) und 63,2 g eine Mittelstellung ein.
Möglicherweise sind Differenzen in der Proteinverdaulichkeit der getesteten Futtervarianten für die beobachteten Eigewichtsunterschiede mit verantwortlich. Außerdem gilt es, den Zusammenhang zur Legeleistung herzustellen. So zeigt die rapsbetonte Fütterungsgruppe unter den LB-Hennen mit 62,1 g das niedrigste Eigewicht, aber zugleich die höchste Legeleistung. In der Eimasseproduktion je AH und Jahr lagen dabei die rapsbetont gefütterten LB-Hennen an der Spitze. Sie konnten ihre niedrigeren Eigewichte also durch eine höhere Legeleistung kompensieren. Analog liegt dieser Sachverhalt bei den LSL.
Der komplette Verzicht auf SES (V2 und V3) führte zu einem signifikanten Anstieg der schlecht zu vermarktenden S-Eier um 10 bis 12 % im ersten Legemonat und zu einem signifikant niedrigeren L- und XL-Anteil bei beiden Herkünften über die gesamte Legeperiode. Auffällig war der relativ hohe Anteil B-Ware (Schmutz- und Knickeier) bei der Futtervariante mit Sonnenblumenschrot (V2) mit ca. 2,3 bis 2,4 % Schmutzeiern bei beiden Genetiken und einer relativ schlechten Schalenstabilität (35,8 N) dieser Versuchsgruppe im Vergleich zu den anderen Futtergruppen bei den Braunlegern.
Möglicherweise sind Differenzen in der Proteinverdaulichkeit der getesteten Futtervarianten für die beobachteten Eigewichtsunterschiede mit verantwortlich. Außerdem gilt es, den Zusammenhang zur Legeleistung herzustellen. So zeigt die rapsbetonte Fütterungsgruppe unter den LB-Hennen mit 62,1 g das niedrigste Eigewicht, aber zugleich die höchste Legeleistung. In der Eimasseproduktion je AH und Jahr lagen dabei die rapsbetont gefütterten LB-Hennen an der Spitze. Sie konnten ihre niedrigeren Eigewichte also durch eine höhere Legeleistung kompensieren. Analog liegt dieser Sachverhalt bei den LSL.
Der komplette Verzicht auf SES (V2 und V3) führte zu einem signifikanten Anstieg der schlecht zu vermarktenden S-Eier um 10 bis 12 % im ersten Legemonat und zu einem signifikant niedrigeren L- und XL-Anteil bei beiden Herkünften über die gesamte Legeperiode. Auffällig war der relativ hohe Anteil B-Ware (Schmutz- und Knickeier) bei der Futtervariante mit Sonnenblumenschrot (V2) mit ca. 2,3 bis 2,4 % Schmutzeiern bei beiden Genetiken und einer relativ schlechten Schalenstabilität (35,8 N) dieser Versuchsgruppe im Vergleich zu den anderen Futtergruppen bei den Braunlegern.
Geruchsabweichungen
Da in der Variante V3 mit 16 % Rapsprodukten die Empfehlung der einzelnen Grenzwerte von 10 % für Rapsextraktionsschrot und 5 % für Rapskuchen/-expeller in der Summe ausgereizt wurden, sollte ein sensorischer Test klären, ob Geruchs- oder/und Geschmacksabweichungen bei den Eiern auftreten. Zurückzuführen sind spezielle Restriktionsvorgaben bei der Fütterung von Braunlegern mit Rapsprodukten auf eine Stoffwechselstörung, durch die das Trimethylamin (TMA) im Raps nicht abgebaut und folglich im Dotter eingelagert wurde. Das führte früher zu den sogenannten Stinkeiern. Inzwischen wurde das Einzelgen, das für die Stoffwechselstörung verantwortlich ist, identifiziert und aus den Braunlegerlinien züchterisch eliminiert.
Trotz der genannten züchterischen Veränderungen konnten von den Prüfern bei 28,4 % der Eier der Variante V3 (rapsbetont) leichte Geruchsabweichungen festgestellt werden. Damit weicht die rapsbetonte Futtervariante V3 signifikant von den anderen Futtermischungen (K: 7,2 %, V1: 12,8 % und V2: 5,6 %) in der Häufigkeit leichter Geruchsveränderung ab. Zu beachten ist dabei, dass selbst in der Kontrollgruppe (ohne Raps) bei 7,2 % der Eier leichte Geruchsabweichungen bei rohen Eiern auftraten. Starke Geruchs- oder signifikante Geschmacksveränderungen am gekochten oder gebratenen Rührei wurden nicht festgestellt. Dazu war aber möglicherweise der Probenumfang mit zehn Eiern je Zubereitungsvariante und Versuchsgruppe zu gering.
Trotz der genannten züchterischen Veränderungen konnten von den Prüfern bei 28,4 % der Eier der Variante V3 (rapsbetont) leichte Geruchsabweichungen festgestellt werden. Damit weicht die rapsbetonte Futtervariante V3 signifikant von den anderen Futtermischungen (K: 7,2 %, V1: 12,8 % und V2: 5,6 %) in der Häufigkeit leichter Geruchsveränderung ab. Zu beachten ist dabei, dass selbst in der Kontrollgruppe (ohne Raps) bei 7,2 % der Eier leichte Geruchsabweichungen bei rohen Eiern auftraten. Starke Geruchs- oder signifikante Geschmacksveränderungen am gekochten oder gebratenen Rührei wurden nicht festgestellt. Dazu war aber möglicherweise der Probenumfang mit zehn Eiern je Zubereitungsvariante und Versuchsgruppe zu gering.